Medien und Kosovo-Krieg
![]() In dieser Ausgabe folgt
der letzte Teil der EinSatz!-Serie zum Kosovo-Krieg. Im Mittelpunkt steht die
mediale Heimatfront, an der während des Krieges gekämpft wurde. Von der "taz"
bis zur "FAZ" waren sich in seltener Einmütigkeit alle einig: Gefordert wurde
der "totale Friedenseinsatz" gegen die "serbischen Barbaren", den "irren Serben"
und "Schlächter" (BILD) Milosevic.
In dieser Ausgabe folgt
der letzte Teil der EinSatz!-Serie zum Kosovo-Krieg. Im Mittelpunkt steht die
mediale Heimatfront, an der während des Krieges gekämpft wurde. Von der "taz"
bis zur "FAZ" waren sich in seltener Einmütigkeit alle einig: Gefordert wurde
der "totale Friedenseinsatz" gegen die "serbischen Barbaren", den "irren Serben"
und "Schlächter" (BILD) Milosevic.
 |
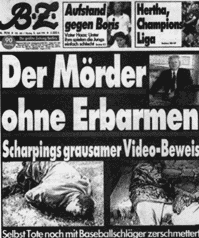 |
Die Kriegsberichterstattung
während des Kosovo-Krieges hat die Mechanismen und Funktionsweise der Medien
deutlich hervortreten lassen. Denn dass Medien den herrschenden Konsens bedienen
und reproduzieren ist eine Alltäglichkeit, die in Extremsituationen wie Kriegen
nur allzu offensichtlich wird. Die Journalisten selbst werfen dann reihenweise
ihr bürgerliches Ideal von der Pflicht zur "objektiven" Information zugunsten
patriotischer Loyalität über den Haufen, um als vertrauenswürdig zu gelten.
Das WIR das sie in ihren Berichten schaffen, schließt sie selbst mit ein. Aber
während diese Feststellung auch auf die Berichterstattung während des ersten
Weltkrieges passt, sind Medien in der heutigen kapitalistischen Informationsgesellschaft
nicht nur verstärkter Konkurrenz unterworfen, in der die Ware Information zuallererst
verkäuflich sein muß und Schnelligkeit zu den obersten Prinzipien gehört. Sie
sind auch eingespannt in militärische und politische Strategien, die die Mediennutzung
im Lauf der (Kriegs-)Geschichte immer weiter perfektioniert haben. So reicht
der bloße Begriff der Propaganda heute nicht mehr aus. Vielmehr werden die Medien
längst als fester Bestandteil der Kriegsführung miteingeplant.
Der Krieg im Kosovo galt dabei als gelungener Testfall für künftige "informations
operations", einem elementaren Bestandteil der "Information Warfare-Strategie".
Deren Ziel besteht in der Informationsüberlegenheit im weitesten Sinne: "Die
Dominanz über das Informationsspektrum ist so entscheidend für einen Konflikt,
wie in früherer Zeit die Besetzung eines Landes oder die Kontrolle über den
Luftraum", so der amerikanische General Ronald R. Fogleman. Von der Überwachung
des Schlachtfeldes per Satellit über die computerisierte Lenkung der militärischen
Intervention bis hin zu den Massenmedien - entscheidend ist die Macht und Verfügungsgewalt
über die erste Nachricht. Um dies durchzusetzen wurden während des Kosovo-Krieges
teils traditionelle, teils moderne Techniken und Möglichkeiten genutzt. Was
die Massenmedien anbelangt, wurden zu Beginn des Krieges teilweise widersprüchliche
Informationen rund um dem Erdball geschickt. Davon aufgeschreckt, richteten
Informationsspezialisten aus den Regierungsreihen am 17. April ein "Media Operations
Center" (MOC) in Brüssel ein, das von Alastair Campbell, dem Blair-Berater,
geleitet wurde. 20 PR-Spezialisten aus europäischen Regierungen und dem Pentagon
arbeiteten im sogenannten "war-room" im NATO-Hauptquartier. Sie sollten die
Statements der NATO und der alliierten Verteidigungsministerien koordinieren
und angleichen. Mit sogenannten "morning massages", die gelegentlich mit "Heute
morgen sollte klar sein..." begannen, wurden die Hauptstädte täglich mit
frisierten Meldungen versorgt. Ergänzt wurde diese Arbeit durch psychologische
Kriegsführung und Kampf gegen die Kommunikationsstruktur der Serben. Allein
in den ersten fünf Wochen wurden 23 serbische Rundfunkstationen und ein Fernsehsender
bombardiert.
 |
| Die mediale Heimatfront: Mitten drinn statt nur dabei. |
Um die eigene
Interpretation des Krieges zu vermarkten wurde mit Falschinformationen, Halbwahrheiten,
verkürzten und gesperrten Informationen operiert. Die angeblichen "Konzentrationslager"
und "Massenvergewaltigungen" waren ebenso wenig zu belegen wie die Existenz
eines "Hufeisenplanes". Doch einmal gebrachte Meldungen wurden, wenn überhaupt,
erst nachTagen dementiert - auf den hinteren Seiten der Auflagenstärksten Zeitungen.
Zu diesem Zeitpunkt spielte dies dann keine Rolle mehr. Auch die blauäugige
These, dass "das erste Opfer des Krieges die Wahrheit" sei, mit der verschiedene
Medien warnten, bleibt letztlich wirkungslos, wenn dem Publikum vorher tagtäglich
eingebläut wird, dass gegnerische Quellen, die schließlich von "Barbaren, Irren"
oder gar dem "Hitler Milosevic" stammen, zuerst gegen den Strich gelesen werden
müssen.
Besonders audiovisuelle Medien dienten als Instrumente der psychologischen Kriegsführung.
Sie sind spätestens seit dem 2. Golfkrieg als essentieller Bestandteil der jeweiligen
militärischen Apparate zu begreifen. Denn das Medium Fernsehen gaukelt z.B.
die umfassende Sichtbarkeit der Welt und somit ein gewisses Maß an Transparenz
vor. Doch Militär-Bilder, computerisierte Animationen, Bilder aus dem Kopf der
Bombe, wo der Zuschauer in Echtzeit Angriffe mitverfolgen kann, und verschwommene
Satellitenbilder zeigen nicht das reale Geschehen, sondern lassen es hinter
den klinisch sauberen Inszenierungen verschwinden. Das Gebiet des Kosovo selbst
war den Kameras entzogen, allenfalls dessen Resultate waren zu beobachten, wie
beispielsweise die Masse der Vertriebenen. Die Fernsehberichterstatter, die
Bilder benötigten, bezogen Stellung an den Flüchtlingslagern und lieferten von
dort aus alltäglich ihre eigenen Bilder und Kommentare. Die Konsequenz: Keine
Informationen über die Ursachen und Hintergründe, sondern subjektivistische
Erlebnisberichte, die zur enormen Emotionalisierung der öffentlichen Diskussion
beitrugen und so den Kriegstreibern in die Hände spielten.
Die militärischen Zentren, die selbst unsichtbar bleiben, konnten so über Sichtbarkeit
und Unsichtbarkeit sowie über die Deutungsmacht der Bilder entscheiden - und
so schließlich entscheidend das Bewusstsein und den öffentlichen Diskurs beeinflussen.
Es geht also nicht mehr nur um pure Propaganda: Die Massenmedien stehen nicht
mehr außerhalb des militärischen Apparates, sondern sind Teil desselben.
![]()