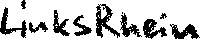 - News - News
|
http://www.free.de/Zope/linksrhein/News/1036599162/index_html
|
|
letzte Änderung: 06/11/02 17:14
|
Grenzregime
Kanonen für den deutschen Diktator
06.11.2002, 17:12, Südkurier
VHS-Veranstaltung am 7.11.02 mit Jean-Francois Bergier über Verflechtungen der Schweiz mit dem Dritten Reich. Astoria Saal, Katzgasse, 19 Uhr
Bild:
Die historische Aufklärungsarbeit der von Jean-Francois Bergier geleiteten Expertenkommission konfrontierte die Schweiz mit ihrer Geschichte während des Zweiten Weltkriegs. Morgen berichtet Bergier von den vor allem wirtschaftlichen Verflechtungen und schuldhaften Verstrickungen seines Landes mit dem Dritten Reich.
Das Schweizer Unternehmen Schießer in Radolfzell fertigte während des Krieges nicht nur Unterhosen, sondern auch Granatzünder - für deutsche Granaten, wie man ergänzen muss. Aus Kanonen der berühmten Schweizer Waffenschmiede Oerlikon-Bührle schossen deutsche Soldaten auf alliierte Truppen, während die Mehrheit der Eidgenossen auf einen Sieg der Anti-Hitler-Koalition hoffte.
Diese Beispiele illustrieren, wie wenig das Eigenbild vom heroischen Kleinstaat realistisch war, der vorgab, dank militärischer Grenzbesetzung, Anbauschlacht und diplomatischer Verhandlungskunst wirtschaftlich selbstständig und politisch neutral geblieben zu sein.
Die großen Grundzüge der wirtschaftlichen und politischen Verbindungen mit dem Dritten Reich sind in Fachkreisen seit vielen Jahren bekannt. Doch erst die Ergebnisse der von der Berner Regierung 1996 eingesetzten "Unabhängigen Expertenkommission Schweiz - Zweiter Weltkrieg" um den Zürcher Wirtschaftshistoriker der ETH Zürich Jean-Francois Bergier (71) brachen endgültig mit den Tabus einer jahrzehntelang beschwiegenen Vergangenheit.
Morgen, Donnerstag, ist Jean-Francois Bergier Gast der Volkshochschule Konstanz. Abends um 19 Uhr wird er im Astoria-Saal der vhs in der Katzgasse die wesentlichen Ergebnisse der Expertenarbeit vorstellen und über das Thema auch mit Blick auf die besondere Lage der Stadt Konstanz an der Schweizer Grenze diskutieren.
Auf die Berichte der Kommission und die Tatsache ihrer Berufung darf die Schweiz von heute stolz sein. Wenn auch spät, so fand sich doch eine politische Mehrheit dafür, gründlicher als zuvor in die Archive des Staates, der großen Unternehmen und Banken schauen zu lassen und das partielle moralische Versagen dieser Institutionen öffentlich zu machen.
Jean-Francois Bergier bilanziert die Arbeit seiner Kommission positiv. Es sei gelungen, allgemeine Thesen zum Verhältnis der Schweiz zum NS-Staat durch präzise Quellen zu unterlegen und erstmals auch die Firmenarchive großer Unternehmen zu untersuchen. Im Vergleich zu den Anfängen der Diskussion, als sich Schweizer Unternehmen wegen ihres Umgangs mit nachrichtenlosen Vermögen von NS-Opfern mit Boykottdrohungen aus den USA konfrontiert sahen, habe sich viel verändert: "Es hat einen Wandel in der Wahrnehmung der Schweizer gegeben: Die Schlussfolgerungen unserer Arbeit werden inzwischen mehr akzeptiert als noch vor einem Jahr", sagt Bergier im SÜDKURIER-Gespräch. Selbst die Generation der Zeitgenossen habe eine "ruhigere Sicht gewonnen", nur eine Minderheit ertrage die historischen Wahrheiten noch immer nicht.
Nachdrücklich unterstreicht der Historiker aber auch die "positiven Aspekte" dieser Zeit: So habe es zwar in den 30er und 40er Jahren in der Schweiz eine Sehnsucht nach starker Staatsautorität und einen erheblichen "mündlichen Antisemitismus" gegeben. Doch zugleich sei belegt, dass sich beispielsweise die Schweizer Justiz deutlich gegen Verwässerungen rechtsstaatlicher Prinzipien gerichtet habe. Zur restriktiven Flüchtlingspolitik des Landes sagt Bergier: "Es wurden viele Flüchtlinge ausgewiesen, aber auch viele aufgenommen." So etwa 1943 im Tessin, als man den flüchtenden italienischen Juden "mit großem Eifer geholfen" habe.
Die innenpolitische Haltung der Schweiz, die den Verteidigungswillen stärkte, die Staatslegende um Wilhelm Tell politisch nutzte und das Volk um die charismatische Figur des Generals Henri Guisan scharte, sei "im positiven Sinne wirkungsmächtig" gewesen.
Professor Bergier ist die Lage an der deutsch-schweizerischen Grenze in Konstanz/Kreuzlingen aus historischer Perspektive vertraut. Der Thurgau war einer der flüchtlingsfeindlichsten Kantone, schreckliche Schicksale spielten sich unter anderem am hiesigen Grenzzaun ab. Die Diskussion um Bergiers Thesen und Ergebnisse dürfte an einem historischen Tatort also besonders anschaulich werden.
Südkurier, 6.11.02