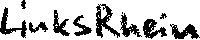 - News - News
|
http://www.free.de/Zope/linksrhein/News/1018379173/index_html
|
|
letzte Änderung: 09/04/02 21:13
|
AKW
Der Frosch kocht langsam
09.04.2002, 21:06, Frankfurter Rundschau
In der Schweiz kämpfen Initiativen gegen ein Atomendlager an der deutschen Grenze
Von Felix Ruhl
Die Schweiz will an der deutschen Grenze, wo bereits fast alle Atomkraftwerke des Landes stehen, ein Endlager für radioaktive Abfälle errichten. Dagegen wehren sich nicht nur Schweizer, sondern auch deutsche Umweltgruppen lautstark. Bedenken gelten der Verunreinigung von Trinkwasser und der Sicherheit der unterirdischen Lagerung in einer Tonschicht. Der grenzüberschreitende alemannische Protest - Stichworte Wyhl und Kaisersaugst - hat Tradition.
Die Schweizer Atomindustrie hat Mühe, Endlager für radioaktiven Müll zu finden. Im konservativen Alpenkanton Nidwalden erweist sich die Bevölkerung als unerwartet renitent gegen den Versuch, in Wellenberg ein Lager für schwach radioaktive Stoffe zu errichten. Den Endlager- Kritikern in der Schweiz stehen mit Einsprachen und Volksabstimmungen vielfältige demokratische Gegenmittel zur Verfügung. Auch über die Landesgrenze hinweg formiert sich Atom-Widerstand. In Zürich und in Süddeutschland kämpfen Umweltgruppen gemeinsam gegen Pläne, am Rhein ein Endlager für hoch radioaktive Stoffe zu installieren.
Der deutsche Bundesverband Bürgerinitiativen Umweltschutz (BBU) hat ein Schreiben an Bundesumweltminister Jürgen Trittin (Grüne) gerichtet und sich beschwert über die Schweizer Absichten, "in provokativer Form direkt an der Grenze zu Jestetten / Baden-Württemberg ein Atomendlager zu errichten". Eduard Bernhard, Vorstandsmitglied des BBU, fühlt sich angesichts der Probebohrungen in Benken (Kanton Zürich) an leidvolle "Gorleben- und Schacht-Konrad-Zeiten" erinnert.
Nach den Erfolgen der Anti-Atomkraft-Bewegung in Deutschland fürchtet er, "dass nun doch noch ein Endlager, nahe an der deutschen Grenze", entstehen könnte. Am Rhein stünden jetzt schon zu viele gefährliche Anlagen. In der Tat sind vier der fünf Schweizer Atomkraftwerke im "Atom-Kanton" Aargau nahe der Grenze angesiedelt, dazu noch das Zwischenlager in Würenlingen. Es könnten auch nach einem möglichen Regierungswechsel eine konservativere Atompolitik in Deutschland entstehen und deutsche AKW ihren Müll dann eventuell in Benken entsorgen wollen, fürchtet Bernhard.
Bern vertritt das Verursacherprinzip. Für Michael Aebersold im Bundesamt für Energie in Bern geht es darum, in der Schweiz produzierten Atommüll auch in der Schweiz zu entsorgen - und dafür den bestmöglichen Standort zu finden. Erforderlich sei eine sichere geologische Umgebung sowie Kühlung, wie sie das Rheinwasser bietet. Benken komme in Betracht, es würden aber auch andere Regionen überprüft. "An der Grenze sind wir in unserem kleinen Land aber immer recht schnell", sagt Michael Aebersold.
Angst im Nachbarland will er ernst nehmen. Deswegen seien deutsche Behörden stets über alle Schritte informiert worden. Atommüll anderer Länder aufzunehmen, sei weder geplant, noch "wäre das politisch durchsetzbar" . Dringlich sei die Angelegenheit sowieso nicht, sagt Aebersold. Zum Abkühlen müsste der Müll erst 40 Jahre zwischengelagert werden: "Bedarf für ein Endlager gibt es erst zwischen 2020 und 2050."
Der Kreistag im deutschen Waldshut hat im Sommer eine Resolution verabschiedet, die den Standort Benken ablehnt. Das Papier lenkt die Aufmerksamkeit auf das große Trinkwasservorkommen. Ein grenznahes Endlager gefährde die Versorgung der Gemeinde Jestetten. Transporte radioaktiver Abfälle auf der Bahn würden zusätzliche Gefahren schaffen. Den Landkreis treibt zudem wie den BBU die Sorge um, Benken könne auch zu einem attraktiven Ort für Atommüll aus anderen Ländern werden. Zwar bestünden zurzeit keine Anhaltspunkte für eine Änderung der Schweizer Gesetze, sagt Jürgen Glocker, Sprecher des Kreises. "Doch in Anbetracht der hohen Betriebs- und Errichtungskosten könnte sich das später einmal ändern", sagt er.
Zu diplomatischen Spannungen zwischen den beiden Ländern - wie zuletzt beim "Luftstreit" um den Flughafen Zürich-Kloten - könnte es kommen, wenn die Schweizer Pläne konkreter werden. Noch allerdings arbeitet die Nationale Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle (Nagra) an einer Gesamtbeurteilung für die geologischen Voraussetzungen eines Tiefenlagers. Der Entsorgungsbericht soll noch in diesem Jahr der Regierung in Bern vorgelegt werden.
Viel Auswahl hat die Nagra nicht. Die Alpen, ein in geologischen Dimensionen betrachtet junges Gebirge, kommen als Lager nicht in Betracht. An die politisch links stehende Bevölkerung in der französischen Schweiz hat die Schweizer Atomwirtschaft unschöne Erinnerungen. Der Oberrhein bei Basel wiederum gilt als erdbebengefährdet. So kommt für eine Entsorgung radioaktiven Materials nur ein kleiner Streifen nördlich der Alpen in Frage.
Im Zürcher Weinland, auf dem Boden der Gemeinde Benken zwischen Zürich und Schaffhausen, hat die Nagra in 400 bis 900 Meter Tiefe eine Schicht "Opalinus-Ton" gefunden. Sie ist gut 100 Meter dick und besteht aus 180 Millionen Jahre altem Sedimentgestein. In der Jurazeit hat sich am Meeresgrund Schlamm aus Tonpartikeln abgelagert. Opalinus leitet sich vom Ammoniten leioceras opalinum ab, den die Wissenschaftler im Ton gefunden haben. Die Ammoniten und Holzstücke waren intakt konserviert. Die Nagra geht deswegen davon aus, dass der Opalinus-Ton im Zürcher Weinland kaum deformiert sei. Ton als Wirtgestein biete eine sichere Isolierung für radioaktive Abfälle in Stahlbehältern, sagt die Nagra.
Der geologische Befund fußt auf zwei methodisch unterschiedlichen Erkundungen. 1991/92 hat die Nagra mit reflexions-seismischen Profilmessungen ein Bild der geologischen Architektur erstellt und ist dabei im Zürcher Weinland auf ein Gebiet mit 50 Quadratkilometern ruhiger Schichtlage gestoßen. Auf der Grundlage wurde im Jahr 1999 bei Benken 1000 Meter tief gebohrt - und der Befund bestätigt. Ein Felslabor im Jura-Gebirge arbeitet an einer tektonischen Studie zu Opalinus- Ton. Im Mont Terri durchschneidet ein Sicherheitsstollen der Jura-Autobahn eine Opalinus-Ton-Schicht in 250 Metern Tiefe. Ergebnis der Beobachtungen: Opalinus-Ton ist dicht.
Die geologischen Studien sind sorgfältig, das erkennen auch Atomkraft-Gegner wie Axel Mayer, Geschäftsführer des Bund für Umwelt und Naturschutz Südlicher Oberrhein (BUND), an. Er kritisiert aber das Vorgehen der Nagra. Zuerst hätten die Schweizer nach einem Endlager in Granit und Gneis gesucht, wären aber auf keine Zone gestoßen, die massiv genug war. Daraufhin hätte man die Liebe zum OpalinusTon entdeckt, woraus Mayer ableitet, "dass bei der Nagra der Stein das Bewusstsein bestimmt".
Er gibt zu bedenken, dass Benken an der europäischen Trinkwasserader Rhein liegt, und nicht nur die Zürcher, sondern mehr noch Deutsche, Franzosen und Holländer mit den Problemen zu kämpfen hätten, wenn der Opalinus-Ton undicht und Radioaktivität in den Rhein gelangen würde. Bei der Lagerung von radioaktivem Material müsse man schließlich in Zeitkategorien von mehreren 100 000 Jahren denken.
Mit seiner Kritik ist der BUND nicht allein. Im Kanton Zürich sind gerade die nötigen Unterschriften für eine Volksinitiative gesammelt worden. Sie verlangt, dass der Bau eines Atomendlagers oder vorbereitende Handlungen eine Volksabstimmung nötig machen. Bisher sind bei derlei Vorhaben im Kanton Zürich Referenden nicht vorgeschrieben.
Mit den Schweizer Anti-Atom-Gruppen arbeitet Axel Mayer gut zusammen. Der grenzüberschreitende Protest hat im Dreiländereck Südbaden-Elsass-Nordwestschweiz eine erfolgreiche Tradition. In den siebziger und achtziger Jahren gelang es den Bürgerinitiativen, AKW-Vorhaben in Wyhl (Kaiserstuhl) und Kaisersaugst (Aargau) zu verhindern. Die Atomindustrie habe seitdem dazugelernt, sagt Mayer. Sie versuche mittlerweile, direkte Konfrontationen zu vermeiden und Entscheidungsprozesse zu atomisieren. Deswegen argumentiere die Nagra stets, die Errichtung eines Atomendlagers stehe erst in 40 Jahren an: "Wenn man einen Frosch in heißes Wasser wirft, springt er heraus. Also setzt man ihn in kaltes Wasser und erhitzt es langsam."
Frankfurter Rundschau 09.04.2002