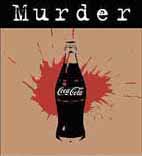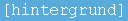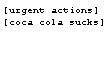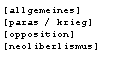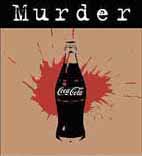Von Krieg und Koka
von Raul Zelik
5 years ago.
Es ist heiß. Zwei ausgemergelte Bauern stapfen barfuss in
einer Pampe aus Kokablättern herum. Es riecht nach Benzin,
Schwefelsäure und irgendwelchen anderen Chemikalien, Zementsäcke
liegen am Boden, allerlei leere Plastikbehälter. Die Vorstellung,
dass man sich das Destillat dieses stinkenden Breis später
einmal freiwillig in die Nase ziehen wird, erzeugt einen brackigen
Geschmack im Mundraum. Ich habe das mit dem Koksen sowieso nie richtig
verstanden. Von der kolumbianischen Seite her betrachtet ist die
ganze Angelegenheit ekelhaft - was nicht unbedingt mit dem Geruch
zu tun hat. Ein Bauer erklärt uns den Verarbeitungsprozess
vom Kokablatt zur Basuco-Paste. Ich nicke, ohne zuzuhören.
Von mir aus könnten sie die Pflanzungen ausrupfen; lieber heute
als morgen. Nicht weil am Ende eine Droge herauskommt, weil die
Flüsse hier nach Benzin stinken oder das Zeug als Legitimation
für eine kaum verhohlene Militärintervention herhalten
muss. Eher wegen der Art, wie das Zeug das Leben hier verändert.
Es sind eben nicht nur Persönlichkeitsstrukturen, die eine
Droge umzukrempeln vermag.
Wir gehen den Hang zu einem Bach hinunter, zwischen Kokasträuchern
hindurch. Ich mag den Anblick, wenn man aus dem dampfigen Regenwald
auf eine Lichtung mit Pflanzungen heraustritt. Die Büsche sind
klein, hellgrün und widerspenstig. Ich denke für einen
Augenblick an das europäische Frühjahr, man kann die Jahreszeiten
hier in den Tropen sehr vermissen. Leonor setzt sich auf einen Felsen
im Flussbett und erzählt von ihrem Vater. Er lebt auf der anderen
Seite der Bergkette, in Antioquia. Fünf Jahre lang hätten
sie und ihr Bruder ihn bekniet, den Kokaanbau aufzugeben, sagt sie.
Man sollte glauben, dass Waffen, familiäre Bindungen und der
geschulte Tonfall von Politaktivisten eine gewisse Autorität
verleihen. Leonor und ihr Bruder sind bei der ELN "Aber erst
jetzt hat er wirklich aufgehört." Sie grinst. Ironie ist
ein gutes Mittel, um Realität zu ertragen. "Er hat auch
aufgehört zu trinken. Er ist jetzt in einer Sekte, sie singen
sehr viel."
Das stimmt. In den Dörfern des Departement Bolívar
reißen einen die adventistischen Gottesdienste, die nicht
‚Messen' heißen, sondern ‚Kulte', als handele es
sich um irgendeine archaische Zusammenkunft, im tiefsten Morgengrauen,
gegen halb 5, aus den Träumen. Sie wiegen einen auch in den
Schlaf, denn die Pfingstler beten viel. Und immer singen sie.
Wir schmeißen Steine ins Wasser. Betrachten die Äste
und Lianen, die ins Flussbett hineinwuchern. Genießen den
Geruch der Holzfeuer, der von einem nahgelegenen Dorf herüberzieht,
und fragen uns, wie lange die Idylle noch Bestand haben wird. Koka
ist ein Vorbote des Krieges. Es ist kapitalistische Erschließung
in ihrer ungezügeltsten, rabiatesten Form. Wo sich der illegale
Handel mit der Droge etabliert, bleibt kein Stein auf dem anderen.
Bis dahin verschlossene Türen werden aufgebrochen und Räume
geflutet: ‚Modernisierung'. Aber ohne ‚Zivilität'.
Zu diesem Zeitpunkt können wir unsere Befürchtungen nicht
artikulieren. Wir haben nur Vorahnungen. Koka ist unmoralisch, sagen
die Politischen - sehr unpolitisch. Man tut sich hier schwer mit
Begriffen. Wenige Monate später wird die ELN ein Projekt beschließen,
um den Kokaanbau innerhalb von fünf Jahren aus der Region zu
verdrängen. Ein aussichtloses Unterfangen, wie man schon zu
diesem Zeitpunkt wissen könnte. Aussichtslos, aber wahrscheinlich
trotzdem richtig. Wir werfen Steine ins Wasser und sagen, dass es
eine gute Idee wäre, die Bauern zur Substitution zu ermuntern.
Dass man Projekte fördern müsste, die Perspektiven eröffnen
- ohne genau zu wissen, was für Projekte. Leonor erzählt
von den Demonstrationen der Bauern gegen die Herbizidbesprühungen
aus der Luft, und ich denke, dass der Widerstandsgeist der Bauern
bewundernswert ist. Vielleicht hat er auch damit zu tun, dass man
hier trotz der Kriegführung aus der Luft immer noch das Gefühl
hat, auf einer Insel zu sitzen. Aber wir wissen, es ist nur eine
Frage der Zeit, bis sie fällt.
2002.
Die Gegend ist staubiger, als ich sie in Erinnerung habe. Das kann
an der außergewöhnlich langen Trockenzeit, aber auch
an der Abholzung liegen. Auf dem Weg in die Serranía San
Lucas kommen wir nur einmal an Kokapflanzungen vorbei - im flachen,
von der Armee kontrollierten Teil der Region. Das hat nichts damit
zu tun, dass die Anbaufläche abgenommen hätte, schon eher
mit dem von uns gewählten Weg. Die Straße von Santa Rosa
del Sur ist die einzige Verbindung, auf der man noch in die Serranía
gelangt. Die Stimmung ist gespannt. Wir stehen zu zwanzigst auf
der Ladefläche eines Pickups; so dicht gedrängt, dass
man sich kaum setzen kann. Darunter ein paar Ausländer, zwei
Dokumentarfilmer: Wir wollen zeigen, dass der Kessel, den Armee
und Paramilitärs um die Serranía errichtet haben, durchlässig
ist und Bilder mit hinausnehmen. Der Staub sticht im Gesicht, trotzdem
starren wir mit zusammen gekniffenen Augen nach vorn und beobachten,
was uns nach der nächsten Kurve erwartet. Der letzte Armeeposten
liegt etwa eine Stunde hinter uns, aber immer noch können wir
auf Paramilitärs stoßen, aus der Luft von Helikoptern
beschossen werden, in die Hände von Eliteeinheiten der Armee
fallen, auf der Piste verunglücken, von einem umstürzenden
Jeep begraben werden oder in ein Gefecht geraten. Es gibt 100 Gründe,
sich zu fürchten.
Die Straße führt hinauf in die Berge. Ich spüre
das warme, klebrige Gefühl, das die Luftfeuchtigkeit auf der
Haut hinterlässt, fast wie Leim, erkenne den Geruch von Grasland
und Wald wieder. Die Höhenlagen sind immer noch von Dschungel
bedeckt, aber überall steigen die Rauchschwaden der Brandrodungen
auf. In den letzten fünf Jahren hat sich vieles verändert.
Der Kokaanbau hat sich ausgebreitet, doch das Gebiet, in dem die
meisten Pflanzungen liegen, ist für uns unerreichbar. Die Ortschaften
zwischen dem Magdalena-Strom und den Ausläufern der Serranía
sind fest in den Händen der Todesschwadronen. San Blas, früher
nur ein Dorf, ist zum größten Koka-Umschlagplatz geworden,
gleichzeitig ist es die wichtigste Basis der Paramilitärs.
Zwischen Ultrarechter und Koka sind die Verbindungen eng. Man kann
sagen, dass das Koka den Paramilitärs die Tür geöffnet
hat: Das schnelle Geld hat gewachsene Strukturen zerstört und
die Besetzung erleichtert. Man kann aber auch sagen, dass Koka den
Anreiz für die Paramilitärs erhöht hat, die Region
zu erobern. Eine illegale Armee zu unterhalten, kostet viel Geld,
und für Todesschwadronen gilt das erst recht. Während
der Guerilla wenigstens zum Teil aus politischer Überzeugung
beigetreten wird, ist die Bezahlung das einzig ernstzunehmende Motiv
für die Mitgliedschaft bei einem Mordkommando.
An einem Hang kommt uns plötzlich ein Jeep entgegen, auf der
Ladefläche zwei Bewaffnete in Camouflage-Uniform. Ich zucke
zusammen, aber die Bäuerin neben mir sagt nur "Guerilla
... ELN". Ich bin erleichtert, aber auch irritiert. Wohin fahren
wir? So weit hinein? Als wir den nächsten Kamm erreichen, sieht
man die Teta de San Lucas, den höchsten Berg der Region. Dunkelgrüner
Wald, wohin das Auge reicht. Neben der Erdpiste handgemalte Schilder,
die vor Minenfeldern warnen. Ich bin durcheinander, seltsame Erinnerungen.
Cediel Mondragón, der uns am Ende der Erdpiste nach zwei
Straßensperren der Guerilla erwartet, ist Sprecher einer Bauernorganisation,
sieht aus wie ein Vietnamese, sagt von sich selbst, von den Chibcha
abzustammen, und ist zweimal im Leben vertrieben worden - einmal
von der Armut, ein zweites Mal von der Armee. Ich frage nach den
Dörfern weiter südlich, wo ich das letzte Mal war. "10
Tage Fußmarsch", erwidert er, "wenn alles glatt
geht." Hier in La Punta baut man kein Koka an; zum einen weil
die Guerilla Neupflanzungen verboten hat, zum anderen weil in der
Gegend Gold geschürft wird. Viel besser ist das nicht: Weniger
Mafia, dafür noch mehr Gift. Das Wasser ist quecksilberverseucht,
zwischen den Häusern stehen Zyanidfässer, es stinkt nach
Blausäure. Ich hake nach, was mit der Idylle geschehen ist.
"Viele Ortschaften sind abgebrannt, Vallecito haben sie dreimal
angezündet. Die Wege sind abgesperrt, manche Täler durch
Herbizideinsätze verwüstet, in den Bergen leben ein paar
Tausend Menschen auf der Flucht. Sie haben Widerstandsdörfer
gegründet und verstecken sich bei Armeeoffensiven." Genaues
weiß auch Cediel nicht. Er telefoniert manchmal mit Gabriel,
einem Bauernführer in jenem Teil der Serranía. Aber
immer nur wenige Sätze. Andere Kommunikationswege haben sie
nicht.
In Kolumbien heißt es, Koka sei zwar für keines der
Probleme im Land verantwortlich, habe aber alle verschärft.
Das stimmt auch hier. Die Kleinbauern in den abgelegenen Gebieten
haben angefangen, Koka anzupflanzen, weil es ihnen als einziges
Produkt das Überleben garantiert. Die ELN hat das toleriert,
ohne davon zu profitieren, die FARC, die den Kokahandel besteuern
und damit gut verdienen, sogar gefördert. Inzwischen haben
sich völlig absurde Geschäftsbeziehungen herausgebildet:
Aus den von der Guerilla kontrollierten Gebiete gelangt die Kokapaste
über Zwischenhändler in die Laboratorien der Paramilitärs,
wo das Zwischenprodukt zu Kokain weiterverarbeitet wird. Die Söldnertruppen
im Dienste der Eliten vermarkten die Drogen und finanzieren damit
ihren Krieg gegen die Guerilla. Weil sie diese nicht vernichten
können, greifen sie die soziale Basis der Aufständischen
an - es sind die Bauern, die Koka pflanzen, um zu überleben.
So bezahlt die Pflanze, die die Bauern ernährt, auch ihre Vertreibung.
Doch über diese Verknüpfung von Drogenhandel und Krieg
gegen die Bevölkerung wird wenig gesprochen, auffallend wenig.
Wie auch über die anderen seltsamen Aspekte des drug business.
Darüber z. B. dass Carlos Castano, Chef der Todesschwadronen,
im Frühjahr dieses Jahres ein Treffen mit den wichtigsten kolumbianischen
Drogenhändlern abgehalten hat. Oder darüber dass das größte
Kartell des Landes, das Cartel del Norte del Valle, als Finanzunternehmen
der Paramilitärs gilt. Dass Castano eine Schlüsselrolle
bei der Festnahme der Kartellchefs von Medellín und Cali
spielte und Anfang der 90er Jahre Chef der Pepes war, jener Todeskommandos,
die Pablo Escobar und seine Leute zu Fall brachten. Dass er dabei
von der Polizei-Eliteeinheit Bloque de Búsqueda und von der
US-Drogenbehörde DEA unterstützt wurde und der damalige
DEA-Verbindungsmann Javier Pena später zum Chef des DEA-Büros
in Bogotá aufstieg. Darüber dass sich Mittelsmänner
Castanos 1999 mit der US-Drogenbehörde trafen, so gut wie keine
Drogenoperationen in den Gebieten der Ultrarechten durchgeführt
werden oder die Paramilitärs mit Kokaingeldern im vergangenen
Herbst 5000 automatische Gewehre bei der nicaraguanischen Polizei
einkauften, ohne dass irgendeine internationale Kontrollinstanz
eingeschritten wäre. Puzzlestücke, die an die Zeiten in
Nicaragua und Afghanistan erinnern, als der Kampf gegen den Kommunismus
mit drug money finanziert wurde.
Der Blick der US-Behörden geht in eine andere Richtung. Man
betont, dass sich der Anbau in Kolumbien in den letzten Jahren stark
ausgeweitet habe und zwar überwiegend in Gebieten, in denen
die FARC präsent sind. Das stimmt, und es ist auch wahr, dass
es hier, in der Serranía San Lucas schwere Konflikte zwischen
den Guerillaorganisationen deswegen gab. Während die ELN eine
Kampagne gegen den Kokaanbau durchführte, ermunterten die FARC
die Kleinbauern dazu, neue Pflanzungen anzulegen. Wahr ist jedoch
auch, dass das ein Nebenschauplatz des Geschäfts ist. Die großen
Gewinne werden eben nicht beim Anbau gemacht, sondern bei der Vermarktung,
und die kontrollieren die Todesschwadronen.
Cediel sagt, dass wir aufbrechen sollten. Inzwischen ist es 4 Uhr
nachmittags. Auf einem staubigen Maultierpfad geht es von La Punta
aus in Richtung der Goldgräberdörfer. Klondyke-Stimmung.
Uns kommen Züge mit Lastentieren entgegen. Rufe von Maultiertreibern,
lautes Schnalzen. Alles hier wird auf den Rücken der mulas
hinein und hinaus transportiert: Benzinfässer, Zyanidtonnen,
Bierkästen, Holzplanken, Dynamitstangen. Cediel erzählt
von den Dörfern der Umgebung. Um das Gebiet liegt ein Ring
der Zerstörung, überall ist gesprüht und bombardiert
worden. Nach nicht mal einer Stunde bleiben wir erschöpft am
Wegrand hocken - Gringos sind nicht besonders gut im Laufen, bei
der Hitze schon gar nicht - und schauen ins Tal. Der Anblick, der
sich uns von nun an bieten wird, ist trostlos: Erosion, verbrannte
Erde, Plastikplanenverschläge, unter denen Mineros Gestein
mahlen. Es gibt keine Idylle hier, aber eine Insel ist es immer
noch. Ein schwitzendes Maultier kämpft sich den Hang hinauf,
schnaufend: der Rücken ist blutig gescheuert. Cediel, der das
belagerte Gebiet nicht verlassen kann, weil man ihn an der ersten
Armeesperre verschwinden lassen würde, sagt, dass die Bauernorganisation,
zu der er gehört, die Leute zu Rodungen und zum Anbau von Nahrungsmitteln
ermuntert. Gold und Koka könne man nicht essen, und außerdem
würden sich normale Bauern nicht so schnell vertreiben lassen
wie coqueros oder mineros. Hinter dem Maultier kommt ein Junge her,
vielleicht 10 Jahre alt. Er schlägt das Tier mit der Breitseite
der Machete, das Mula schleppt sich weiter. Wir bleiben sitzen,
es ist immer noch heiß. 20 Stunden am Stück, heißt
es, sind die Treiber unterwegs. Man weiß nicht, wen man mehr
bemitleiden soll - die Treiber oder die Tiere. Cediel zeigt Richtung
Tiquisio, die Berge leuchten im Sonnenuntergang. Auch dort wird
Koka gepflanzt. Eigentlich hätte er uns dort hinbringen sollen,
aber jetzt scheint der Weg zu lang und wohl auch zu gefährlich.
An den Rändern der Insel kommt man mit der Angst nicht gut
klar. Ich denke: Kapitalismus rabiat. 2 Millionen Vertriebene, für
den Aufbau einer Organisation wird man erschossen, das drug business
hat Mord zum ganz normalen Konfliktbewältigungsmittel gemacht.
In dieser Scheiße versucht sich jeder allein durchzuschlagen,
und diejenigen, die das nicht tun, werden massakriert. Sicher, das
alles hat nicht erst mit Koka angefangen, aber trotzdem stimmt der
Satz auch in diesem Fall: Koka hat alles schlimmer gemacht. Es hat
dazu geführt, dass man keine Hoffnung mehr hat, kein Licht
am Ende des Tunnels mehr sieht. "Sie könnten ihn auch
anders bezahlen", sage ich, "ihren Krieg. Z. B. mit Gold.
"Sicher." Cediel lacht. Cediel scheint immer gut gelaunt,
selbst mitten im Tunnel. Er macht sich einfach selbst Licht, wenn
er keins hat. "Nur hätten sie dann nicht so viel Geld.
Nicht einen Bruchteil so viel. Und dann würden sie den Krieg
auch irgendwann mal verlieren."
|