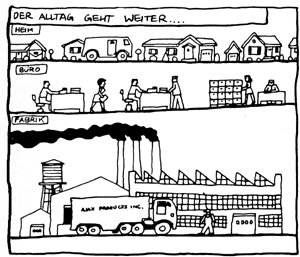 Soziale
versus innere Sicherheit:
Soziale
versus innere Sicherheit:Senat einpacken!
Widerstand anpacken!
Wir wollen keinen besseren Kapitalismus - sondern gar keinen!
Seit mehr als einem halben Jahr regieren
CDU-Schill-FDP nun schon in Hamburg. Der Widerstand gegen die Regierung fand
ihren Ausdruck in zahlreichen vielfältigen Gegenveranstaltungen, wie z.B. der
Demo gegen die Senatsvereidigung oder dem Innenstadtaktionstag. Zunächst waren
diese Aktionen überwiegend von unabhängigen autonomen Kreisen dominiert. Doch
seitdem der Kurs des Senats deutlicher spürbar wird durch die massiven
Kürzungen im sozialen Bereich, regt sich nun auch Widerstand in breiteren
Kreisen. So demonstrierten am 16.04 diesen Jahres bis zu 10.000 Menschen unter
dem Motto: „Der Senat soll einpacken!" Aufgerufen hatte ein breites
Bündnis um Ver.di und Sozialpolitische Opposition.
Doch das soll noch nicht alles sein: Am
8. Juni wird an der HWP eine Konferenz „Lichter der Großstadt - gegen
Sicherheit und Ordnung für soziale Grundrechte" stattfinden. Als
Teil der radikalen Linken sind wir davon überzeugt, dass der notwendige Protest
nur Erfolg haben kann, wenn er sich außerparlamentarisch, also auf der Straße
manifestiert. Politische Interventionen dürfen sich nicht auf die wenigen
Wahlen beschränken, wir müssen den Vorhaben von Schwarz- Schill jetzt den
Knüppel zwischen die Beine werfen! Um
unsere Positionen stärker sichtbar zu machen und den Protest in entschiedenen
Widerstand umzuwandeln, brauchen wir eine stärkere Vernetzung der verschiedenen
Betroffenen sowie eine Absage an rein staatsfixierte Appelle.
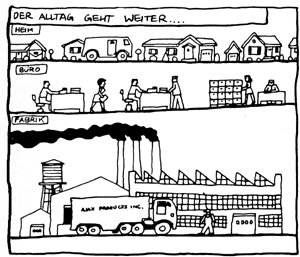 Soziale
versus innere Sicherheit:
Soziale
versus innere Sicherheit:
Der derzeit stattfindende Umbau des Sozialstaates zu einem Sicherheitsstaat ist nicht zu übersehen. Die Rolle des Nationalstaates ist angesichts des Ausbaus staatlicher Kontrollfunktionen und polizeilicher Befugnisse auf nationaler Ebene dabei nicht, wie oft behauptet, vermindert, sondern nur verändert. Auch die Abgrenzungsmechanismen, die zur Konstitution der Nation gehören, bleiben wirksam: rechte Parteien, die völkisches Denken mit liberalen Tendenzen im Parteiprogramm verbinden, gewinnen europaweit an Bedeutung.
Auf der Seite der Sozialpolitik bietet sich folgendes Bild: wurde noch in den 70er Jahren eine auf Ausgleich zwischen Arm und Reich bedachte Sozialpolitik zumindest diskutiert und in Ansätzen verwirklicht, verkommen die immer geringer werdenden staatlichen Aufwendungen (Sozialhilfe, Arbeitslosenhilfe, Geld für Frauenprojekte...) zu rein karitativen Maßnahmen, die nur mehr die schlimmsten sichtbaren Auswirkungen der Armut bzw. Benachteiligung auffangen können.
Gleichzeitig werden die Zuwendungen verstärkt mit Zwängen belegt: „Wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen" . Ein Beispiel dafür ist Robert Kochs Sozialhilfemodell für Hessen, welches am „amerikanischen Vorbild" orientiert ist. Ein weiteres ist das Zurechtstutzen der Universitäten zu Hochdruck-Eliteschmieden.
Während die Sozialpolitik also verstärkt auf Selektivität setzt, ist im Bereich der Inneren Sicherheit das Gegenteil zu beobachten: Ihr Umfang steigt insgesamt und gleichzeitig werden die Maßnahmen ungezielter, tendenziell gegen jedes abweichende Verhalten gerichtet und verstärkt präventiv, also zur Verhinderung strafbaren oder unerwünschten Verhaltens angewendet. Diese Politik stützt sich auf die Konstruktion einer diffusen, allgegenwärtigen Gefahr, sei es durch TerroristInnen, IslamistInnen, DrogendealerInnen, MigrantInnen oder wen auch immer.
Wie real diese Bedrohungen sind, lässt sich kaum ermitteln. Einerseits besteht tatsächlich ein Zusammenhang zwischen Armut und gesellschaftlicher Desintegration und erhöhter Kriminalität, andererseits werden Ursachen der Kriminalität in den Statistiken nicht berücksichtigt und ebenso wenig zwischen sichtbarer und unsichtbarer (z.B. Wirtschaftskriminalität) unterschieden.
Diese in jedem Fall verzerrte Darstellung schürt vage Ängste, die dann meist auf ohnehin gesellschaftlich stigmatisierte Gruppen (Arme, Nichtdeutsche) projiziert werden.
Freiheit stirbt mit Sicherheit
Durch die Rede von der Allgegenwart von Gefahr wird der flächendeckende Ausbau von Kontrolle und Überwachung legitimiert. Die Aufhebung der Trennung von Polizei und Geheimdiensten wurde schon in der Auseinandersetzung über den „großen Lauschangriff" seitens der Sicherheitsstrategen gefordert. Schon damals regte sich kaum Widerstand in der deutschen Bevölkerung gegen den immer wieder in die Privatsphäre vordringenden Überwachungsstaat.
Heute protestieren nur noch die Datenschützer selbst, also staatliche Angestellte, stellenweise gegen diese Praxis. Waren es damals die russischen oder albanischen Banden, der „organisierten Kriminalität", so hat sich das Feindbild nach dem 11. September klar hin zum „islamistischen Fundamentalisten" verschoben. Das Prinzip der rassistischen Stigmatisierung bleibt das gleiche, ebenso wie das Ziel: Sicherung des staatlichen Eingriffsrechts in die bürgerlichen Freiheitsrechte. Der Staat baut sich hier ein Instrumentarium zusammen, das prinzipiell, unabhängig von anzunehmenden Erfolg, auf beliebige Objekte anwendbar ist.
Die Allgegenwart von Kontrolle und Überwachung ist für den sozial verschlankten Staat herausragende Staatsfunktion. Ihr kommt nicht nur die Aufgabe zu, subversive Taten zu verfolgen und zu verhüten, sondern sie hat auch eine ideologisch legitimatorische Funktion. Die propagandistische Mobilisierung folgt zwei Prinzipien:
1. Dem der Ausgrenzung, indem die Gruppen, die als potenzielle Gefahr definiert wurden, vertrieben, unsichtbar gemacht und an den Rand der Städte und Gesellschaft verdrängt werden.
2. Dem der Homogenisierung, indem jene Ausgrenzung zur Konstruktion einer weitgehend konfliktfreien Gruppe in der gesellschaftlichen „Mitte" mit einem gemeinsamen Sicherheitsbedürfnis benutzt wird.
Gleichzeitig wird versucht, Widerstandspotentiale vermehrt einzubinden. Im Rahmen von Runden Tischen und anderen Formen der Bürgerbeteiligung. Das Ganze wird unter dem Begriff „Zivilgesellschaft" als Alternative zur staatlichen Regulation abgefeiert - jedoch funktioniert diese Zivilgesellschaft nach genau denselben Mechanismen (Rassismus, Sexismus, Ausgrenzung) wie der Staat und reproduziert diese. Abweichende Positionen werden durch Integration neutralisiert oder ihnen wird bei zu aufmüpfigem Verhalten durch Ausschluss die Artikulationsmöglichkeit entzogen.
Der dabei erzielte scheinbare Konsens, zu dem Medien, Bildungssystem und Unterhaltungsindustrie das Ihre beitragen, beruht auf einem antiutopischen Bewusstsein: Die bestehenden gesellschaftlichen, ökonomischen und politischen Verhältnisse werden als unabänderlich dargestellt, der Kapitalismus als Ende der Geschichte gefeiert und damit alle Gedanken an Alternativen von vornherein lächerlich gemacht.
In Hamburg, wie auch gesamtdeutsch, unterscheiden sich die Vorstellungen der etablierten Parteien kaum. Entsprechend schwachbrüstig ist auch die Kritik an der sozialen Kahlschlagspolitik und gleichzeitigen Aufrüstung nach innen, wenn sie sich nur personalisiert an Schill äußert, bzw. sich nur an der Politik des Schwarz-Schill-Senats entlädt.
Hierin drückt sich stets die Hoffnung aus, eine sozialdemokratische Regierung (evtl. mit grünen Tupfen) würde es besser machen. Autoritäre Sicherheitspolitik ist aber keine Erfindung der Rechten. Spätestens auf Bundesebene ließen sich Schilys Terrorpakete wunderbar als Beispiel heranziehen. Doch bleiben wir in Hamburg.
„Law and order is a labour issue"
Eine der ersten Amtshandlungen des neuen schwarz- braunen Senats war es, die Polizeikommission aufzulösen. Dies ist ein Skandal und zeigt den dreisten Umgang der neuen Regierungskoalition mit missliebigen Elementen demokratischer Kontrolle. Doch bitte den Grund für die Arbeit der Kommission nicht vergessen: Sie wurde gegründet als Reaktion auf den Polizeiskandal 1994. Wir erinnern uns an massive rassistische Übergriffe der Hamburger Polizei, systematisch gedeckelt durch den Korpsgeist. Als Konsequenz wurde eine externe Kontrollstelle mit vollem Einblick in die Arbeitsabläufe der Polizei gebildet.
Bereits der 1. Jahresbericht stellt fest: es gibt einen institutionellen Rassismus und Sexismus bei der Polizei, begleitet von massivem Mobbing gegen BeamtInnen, die sich dagegen wehren. Laut der Kommission unterstützt die Staatsanwaltschaft den Korpsgeist, indem auch offensichtlich abgesprochene Aussagen von Bullen vor Gericht größere Glaubwürdigkeit eingeräumt wird als Personen, die gegen diese klagen. Der Bericht ist insgesamt sehr vorsichtig formuliert, trotzdem bricht in oberen Etagen Empörung aus, damals besonders bei Justus Woydt (Polizeipräsident) und dem autofreien Konrad Freiberg (Vorsitzender GdP).
Ähnlich konsequent funktioniert sozialdemokratische Sicherheitspolitik in Sachen E- Schicht- Auflösung: die „Gruppe zur Präsenzverstärkung" übernimmt personell wie strukturell Aufgaben der wegen etlicher skandalträchtiger Übergriffe aufgelösten E-Schicht: Provokation, Überwachung von politischen AktivistInnen, rassistische Verdachtskontrollen. Unter einem rotgrünen Senat wird das Schanzenviertel zur faktischen No-Go-Area für Schwarze. Wird von Umstehenden auf die rassistische Komponente eines solchen Generalverdachtes hingewiesen und die Routine der Kontrollen gestört, werden Vorwürfe wie Landfriedensbruch, Nötigung etc. erhoben. Die Justiz (nicht nur in Form eines einzelnen durchgeknallten Amtsrichters) unterstützt dieses Vorgehen mit tatsächlichen Verurteilungen. Doch nicht nur im brisanten Schanzenviertel:
Dass 14-jährige im Knast (Hahnöfersand) eingesperrt wurden, hat zu SPD regierten Zeiten nicht einmal zum Skandal gereicht. So wurden im Februar 1999 einige minderjährige Migranten dort mehrere Wochen lang inhaftiert.
Insgesamt
hat es auch unter dem rotgrünen Senat eine Beschleunigung von staatlichem und
gesellschaftlichem Rassismus gegeben. So fanden die meisten der 2189
Abschiebungen des letzten Jahres (2001) vor dem Regierungswechsel statt - dies
ist die höchste Zahl von Abschiebungen aus Hamburg seit 1995. Die Hälfte der
Abgeschobenen wurde direkt aus der Abschiebehaft oder dem Knast in die Flugzeuge
gesetzt.
Der Hamburger Flüchtlingsfonds listete auf, wie sozialdemokratische Behörden
die Abschiebungen durchführen ließen: „Überfallartige Festnahmen in
Unterkünften in den frühen Morgenstunden; sofortiger Transport zum Flughafen,
ohne dass Anwältinnen oder ÄrztInnen informiert wurden; Familien wurden
auseinandergerissen, Familienangehörige in Abschiebehaft genommen.".
Innensenator Scholz verkündete stolz: ‚In Hamburg wird effektiver abgeschoben
als in Bayern!’ Das wird sich in Zukunft wohl kaum ändern. Nicht umsonst hat
Innensenator Schill etwa den bisherigen Leiter der Hamburger Ausländerbehörde,
Ralph Bornhöft, ausdrücklich für seine Arbeit gelobt und seine Amtszeit
verlängert.
Und auch die nach der Ermordung Achidi J‘s endlich kritisierten Brechmitteleinsätze sind keine Erfindung Schills, sie wurden bereits im Juni 2001 vom rot-grünen Senat eingeführt. Unter anderem Erhard Pumm, Vorsitzender des DGB Hamburg, hat als Abgeordneter der SPD in der Bürgerschaft dem Beginn der Brechmitteleinsätze zugestimmt. Die Grünen hatten zuvor zwar Bedenken geäußert, sich dann aber der Koalitionsdisziplin gebeugt. Bei der rotgrünen Entscheidungsfindung im Sommer war auch ein Papier vom 22. August 1991 bekannt, in dem es unmissverständlich zum zwangsweisen Brechmitteleinsatz hieß: „Es besteht beim Erbrechen eine nicht unerhebliche Gesundheitsgefährdung z. B. durch Verletzung der Speiseröhre oder Einatmen von Erbrochenem." Autor dieser Expertise war Klaus Püschel. Seit die SPD sich aber im Juni für Brechmittel aussprach, ist auch Püschel dafür.
Die vielfältigen Ausgrenzungspraktiken müssen also nicht parteienspezifisch, sondern als systemimmanent bekämpft werden. Wie der Kapitalismus, so werden auch seine aktuellen Formen wie die neoliberale Globalisierung als unwiderstehliche Sachzwänge dargestellt. Die Realität sieht anders aus:
Geschichte wird gemacht. Von Menschen.
Forderungen nach staatlicher Regulation können in Einzelfällen emanzipatorisch wirken. Solange sie aber das Übel nicht an der Wurzel packen, kann die Illusion entstehen, die Lösung liege in einer Rückkehr zum Wohlfahrtsstaat der Siebziger Jahre. Dem ist nicht so. Nicht nur wegen leerer Staatskassen und angeblicher Nichtfinanzierbarkeit sozialer Politik wurde der Klassenkompromiss aufgekündigt, sondern aus klaren Machtverhältnissen heraus.
Während konkrete Kämpfe für die Wiederaneignung gesellschaftlich produzierten Reichtums (die sich zum Beispiel in der Forderung nach freien Kindertagesplätzen, guter Gesundheitsversorgung, Existenzgeld, also in realistischen Formeln für menschenwürdiges Leben unabhängig vom individuellen Zwang zur Unterwerfung unter das Lohnarbeits- und Leistungssystem ausdrücken) von uns unterstützt werden, sehen wir es für ihren Erfolg als unabdingbar an, zwei Facetten noch stärker zu betonen:
1. Der Zusammenhang von Kürzungspolitik im sozialen Bereich und Ausbau der Elemente des autoritären Sicherheitsstaates müssen als zwei Seiten der gleichen Medaille verstärkt thematisiert werden. Hierfür ist der Blick über den unmittelbar betroffenen Teilbereich hinaus vonnöten. Der neoliberale Angriff auf das Sozialsystem und die Verstärkung des staatlichen Zwanges zur Arbeit und zur Unterordnung unter staatliche Kontrolle gehen Hand in Hand.
2. Die grundlegenden Ausgrenzungsstrukturen des derzeitigen Diskurses müssen noch deutlicher historisch als kapitalismusimmanentes Phänomen (das heißt: unabhängig von Parteiprogrammatik) herausgearbeitet werden. Forderungen nach sozialer Wohlfahrt sind zwar tagespolitiktauglich zu artikulieren, dürfen aber nicht in einem Appell an den Staat nach Re-Regulierung stehen bleiben.
Für uns heißt das: Den autoritären, rassistischen Sicherheitsstaat nicht nur auf der institutionellen Erscheinungsebene zu bekämpfen, sondern die ihm vorgelagerte sozialdarwinistische Ideologie einschließlich ihrer rassistischen Elemente und der darin enthaltenen Arbeitsideologie anzugreifen.
Beteiligt euch zahlreich an der Konferenz am 8.6 ab 10 Uhr in der HWP!
Soziale Unzufriedenheit vergemeinschaften - werdet gemein!